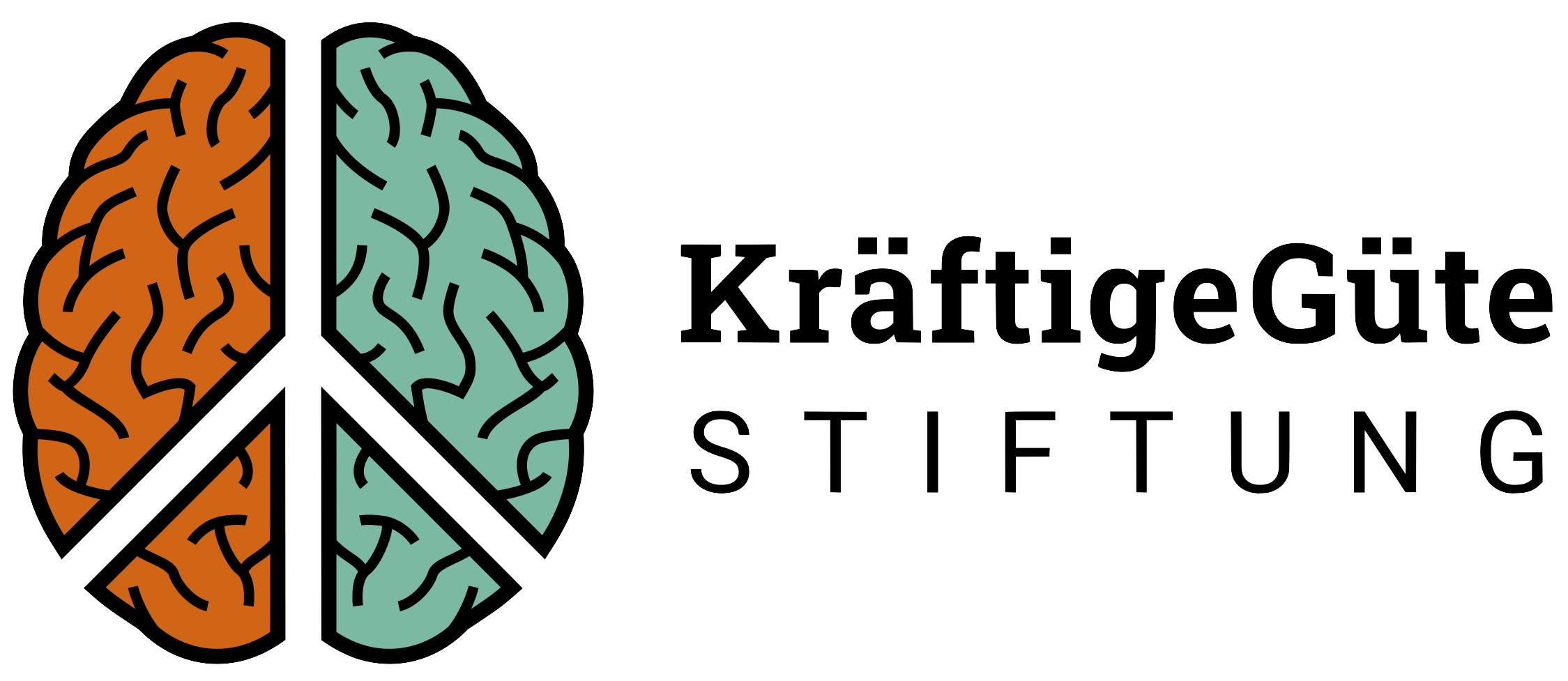Von Selina Schöberl
Acht bis zehn Quadratmeter – so groß ist eine durchschnittliche Zelle für Untersuchungshaft in Deutschland. In der Zelle gibt es meist ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank, ein Waschbecken, einen Mülleimer und eine Toilette. Die Fenster sind vergittert, die massiven Türen verschlossen. Eine Stunde pro Tag dürfen Menschen in U-Haft nach draußen. Ansonsten warten Inhaftierte meist drei bis zwölf Monate lang auf den Beginn ihres Prozesses.
In Europa befinden sich Hunderttausende Menschen in Untersuchungshaft – ohne Verurteilung, manchmal nur wegen fehlender Alternativen. Das hat schwerwiegende Folgen für Betroffene, besonders sozial Benachteiligte.
Dabei gibt es mildere und effektivere Mittel wie den elektronisch überwachten Hausarrest. Expert:innen sehen darin eine echte Chance für mehr Menschlichkeit im Stafvollzug. Hessen gilt hier deutschlandweit als Vorreiter; das Justizministerium zieht eine positive Bilanz.
Wer hier sitzt, gilt vor dem Gesetz als unschuldig. Die U-Haft soll sicherstellen, dass jemand zur Verhandlung erscheint oder Beweise nicht manipuliert werden. Auch der Schutz der Bevölkerung vor möglichen Straftaten der Beschuldigten soll durch die U-Haft gewährleistet werden. Doch U-Haft bedeutet auch einen extremen Eingriff in die Rechte und das Leben der Beschuldigten.
Ein Blick hinter die Gitter der Untersuchungshaft
Etwa 12.000 Menschen sitzen in Deutschland in U-Haft. Angeordnet wird sie in der Regel bei Fluchtgefahr, Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln oder dem Verdacht auf weitere Straftaten. Besonders häufig wird Fluchtgefahr bei Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit oder fehlendem familiären Rückhalt unterstellt. Sozial und gesellschaftlich benachteiligte Menschen sitzen oft wochen- oder monatelang in Haft, ohne dass ein Urteil gesprochen wurde – nicht selten wegen Bagatelldelikten wie Schwarzfahren oder Ladendiebstahl.
Dabei zeigen jüngste Erkenntnisse aus der internationalen Forschung: Schon ein einzelner Tag in Untersuchungshaft kann erhebliche und lang anhaltende Folgen haben, etwa den Verlust von Arbeitsplatz, Wohnung oder Therapiezugang oder psychische Belastungen. Besonders alarmierend ist das stark erhöhte Suizid- und Sterberisiko in den ersten Tagen hinter Gittern.
Die Drastik des Rechtsmittels wird zusätzlich vor dem Hintergrund diverser Studien kritisiert, die zeigen, dass 42 Prozent aller U-Haft-Fälle in milden Strafen wie Geldbußen, Bewährung oder Freisprüchen enden. Auch die Fluchtgefahr stellt sich in 92 Prozent der Fälle als falsch heraus.
Darüber hinaus verfehlt die U-Haft häufig ihre beabsichtigte Wirkung: Sie steigert das Risiko erneuter Straftaten und verringert sogar die Wahrscheinlichkeit, dass Beschuldigte vor Gericht erscheinen. Der soziale Druck in der Haft führt zudem zu übereilten Geständnissen – oft Unschuldiger.
Elektronische Fußfessel als menschlichere Alternative
Strafrechtler wie Prof. Hans-Jörg Albrecht warnen daher, die Untersuchungshaft untergrabe die Fairness eines Verfahrens und sollte nur mit äußerster Zurückhaltung angewandt werden. Seit langem fordert er stattdessen weniger drastische Ermittlungsmaßnahmen. Als eine geeignete Alternative hat sich die elektronische Fußfessel herausgestellt, die bereits als etabliertes Mittel zur Vermeidung von Untersuchungshaft gilt. Sie sei als „milderes Mittel“ ein „Erfolgsmodell“, weil vergleichsweise wenig in das Leben der Betroffenen eingegriffen würde und sie nicht an den Pranger gestellt werden würden, sagte Albrecht.
Er war zur Zeit des ersten Modellversuchs Anfang der 2000er Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, das den Versuch in Hessen wissenschaftlich begleitete. Hessen gilt als Vorreiter in dem Bereich, schon ab 2007 führte das Bundesland die Präsenzkontrolle mit elektronischer Fußfessel flächendeckend ein.
Der Erfolg der Fessel liegt darin, im Vergleich zur Haft weniger stark in das Leben der Betroffenen einzugreifen – sie verlieren nicht automatisch Wohnung, Job oder soziale Bindungen. Gleichzeitig minimiert die Fußfessel das Fluchtrisiko und kann so die Teilnahme an bevorstehenden Prozessterminen sichern. Darüber hinaus ermöglicht die Fußfessel die genaue Ermittlung von Standort und Bewegungsmustern der Beschuldigten – etwa zum Schutz potenzieller Opfer.
Auch weitere Expert:innen betonen die Vorteile: Der elektronisch überwachte Hausarrest könne spezialpräventiv wirken, also einer Rückfallkriminalität vorbeugen – und das ohne die negativen Folgen der U-Haft. Zwar eigne sich das Modell nicht für alle, da etwa eine feste Wohnanschrift erforderlich ist. Doch wer die Voraussetzungen erfüllt, profitiere spürbar.
„Es hat sich gut bewährt, es gab bislang keinerlei Vorfälle bei denjenigen, die mit der spanischen Fußfessel geschützt wurden“.
Christian Heinz, Justizminister Hessen
Erfolg in Hessen mit spanischem Modell
Inzwischen geht es bei der Fußfessel nicht mehr nur um die Kontrolle der Präsenz einer Person an einem bestimmten Ort, wie beim Hausarrest, sondern es können auch Bewegungen mittels der elektronischen Aufenthaltsüberwachung nachverfolgt werden. Im Fokus steht dabei die Fußfessel nach dem spanischen Modell: Hierbei tragen Täter:innen eine GPS-basierte Fußfessel, die in Echtzeit mit einem GPS-Gerät der Opfer kommuniziert, um Schutz bei häuslicher Gewalt und Stalking sicherzustellen. In Spanien hat die Methode bereits Wirkung im Kampf gegen Femizide gezeigt: Laut dem Innenministerium des Landes kam es seit der Einführung bei keinem der rund 13.000 Fälle zu einer Tötung.
„Es ist an der Zeit, dass wir dieses Instrument auch in Deutschland flächendeckend einsetzen, um insbesondere Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen.“
Stefanie Hubig, Bundesjustizministerin
Und auch das hessische Justizministerium zog nach einem halben Jahr der Nutzung bereits eine positive Zwischenbilanz. Mit der verbesserten technischen Erfassung war die Zahl der registrierten Vorfälle seit Einführung der neuen Technik, etwa bei Verstößen gegen Annäherungsverbote, zwar um etwa ein Drittel gestiegen. Konkrete Übergriffs- oder Angriffsversuche habe es trotzdem nicht gegeben. „Es hat sich gut bewährt, es gab bislang keinerlei Vorfälle bei denjenigen, die mit der spanischen Fußfessel geschützt wurden“, sagte Hessens Justizminister Christian Heinz.

Aktuell arbeitet das deutsche Bundesjustizministerium an einer deutschlandweiten Implementierung des Modells im Rahmen einer Erweiterung des Gewaltschutzgesetzes – vor allem zur Aufenthaltsüberwachung in Hochrisikofällen. „Elektronische Fußfesseln können Leben retten. Das zeigen die Erfahrungen in Spanien“, sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. „Es ist an der Zeit, dass wir dieses Instrument auch in Deutschland flächendeckend einsetzen, um insbesondere Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen.“
Neben dem Schutz von potenziellen Opfern sieht die geplante Gesetzesänderung auch die Möglichkeit der Anordnung von Anti-Gewalt-Trainings für Täter:innen vor. Diesen sollen dadurch Lösungswege aufgezeigt werden, Konflikte künftig gewaltfrei zu lösen. TERRE DES FEMMES begrüßt diese Pläne. „Es braucht natürlich trotzdem ein Zusammenspiel von Verfahren, die Fußfessel allein reicht nicht aus“, sagte Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin der Frauenrechtsorganisation. Die Trainings seien „als flankierende Maßnahme sehr wichtig“.
Ein europäischer Ansatz für mehr Menschlichkeit
Ohnehin ist die Fußfessel nur eine Option unter vielen, um Täter:innen wie Opfern mit mehr Güte zu begegnen: Gerichtshilfe-Modelle, psychosoziale Begleitung oder gemeinnützige Arbeit können je nach Einzelfall ebenfalls dazu beitragen, Haft zu vermeiden. Entscheidend ist, dass Alternativen nicht pauschal ausgeschlossen, sondern individuell geprüft und professionell umgesetzt werden.
Im europäischen Kontext wurde mit PRE-TRIAD (Pre-Trial Detention – Reducing the Use of Pre-Trial Detention) dazu ein länderübergreifendes Netzwerk gegründet, das sich von 2020 bis 2022 intensiv mit der Frage befasste, wie unnötige Untersuchungshaft vermieden werden kann – insbesondere bei Bagatelldelikten, oder wenn keine Fluchtgefahr besteht.
Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission und dem Bundesministerium für Justiz finanziert. Beteiligt waren juristische und soziale Organisationen aus mehreren Ländern, darunter Strafverteidiger:innen, Menschenrechtsorganisationen, Universitäten sowie Justizministerien. PRE-TRIAD untersuchte, warum U-Haft in vielen europäischen Ländern trotz bestehender Alternativen häufig angeordnet wird.
Im Fokus standen gesetzliche Rahmenbedingungen, gerichtliche Begründungsmuster und strukturelle Hindernisse. Ziel war es, ein europäisches Problembewusstsein zu schaffen, Handlungsspielräume aufzuzeigen und Fachwelt sowie Politik für alternative Maßnahmen zu sensibilisieren. Auch Fortbildungsangebote für Justizakteur:innen waren Teil der Strategie.
Weitere gütekräftige Alternativen zur U-Haft und Workshops für Jurist:innen
In diesem Zusammenhang prüfte PRE-TRIAD auch die Praxistauglichkeit der Alternativen zum Freiheitsentzug. Ein wichtiger Baustein waren Sozialarbeiter:innen, die bei der Wohnungssuche helfen, Kontakt mit Familie und Arbeitgeber:innen halten, Beratungsgespräche führen oder psychische Stabilisierung anbieten. So werden stabile Lebensverhältnisse gefördert – eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Beschuldigte auch ohne U-Haft zuverlässig zu Gerichtsterminen erscheinen können.
Weitere Bausteine sind Meldeauflagen, die Verpflichtung zu regelmäßigen Gesprächen oder die Unterstützung durch Sozialdienste. Die Menschen behalten ihre Lebensgrundlage – Wohnung, Familie, Arbeit – und damit die Chance auf einen stabilen Alltag.
Das Projekt legte darüber hinaus offen, dass es in Europa große Unterschiede beim Einsatz von Untersuchungshaft gibt,etwa bei den Haftgründen, der Dauer oder der Verfügbarkeit von Alternativen. U-Haft wird häufig nicht aus einer Notwendigkeit heraus, sondern aufgrund von Unsicherheit, fehlenden Wissens oder Routine angeordnet. Viele Richter:innen greifen zur U-Haft, obwohl mildere Maßnahmen zur Verfügung stünden. Hier setzte das Projekt gezielt an, um Wissen über Alternativen zu verbreiten und Vertrauen in deren Wirksamkeit zu stärken.
In mehreren nationalen und internationalen Workshops und Schulungen für Justizpersonal sowie durch die Veröffentlichung von Studien und Leitfäden wurden wurden Handlungsspielräume aufgezeigt und Richter:innen, Staatsanwält:innen und Strafverteidiger:innen über bestehende Alternativen zur U-Haft informiert.
Konsequent weiterdenken
Der elektronische Hausarrest ist kein Allheilmittel, doch sein erfolgreicher Einsatz in Hessen und auch in anderen Ländern wie Spanien zeigt: Gütekräftige Alternativen zur U-Haft sind möglich und wirksam.
Organisationen wie Fair Trials weisen darauf hin, dass europaweit weiterhin zu oft auf Untersuchungshaft zurückgegriffen wird und fordert deshalb, dass Staaten U-Haft als letztes Mittel einsetzen und Alternativen verbindlich prüfen. Gleichzeitig braucht es europaweite Standards und regelmäßige Haftprüfungen, um Transparenz und Fairness sicherzustellen.
Reformen allein werden dafür nicht ausreichen. Um unnötige Inhaftierungen zu vermeiden, muss auch die Prävention gestärkt werden: Sozialarbeit, Bildungsangebote und psychologische Unterstützung können helfen, dass es in vielen Fällen gar nicht erst zu Straftaten kommt.
Beitragsbild: Heino Eisner via Unsplash