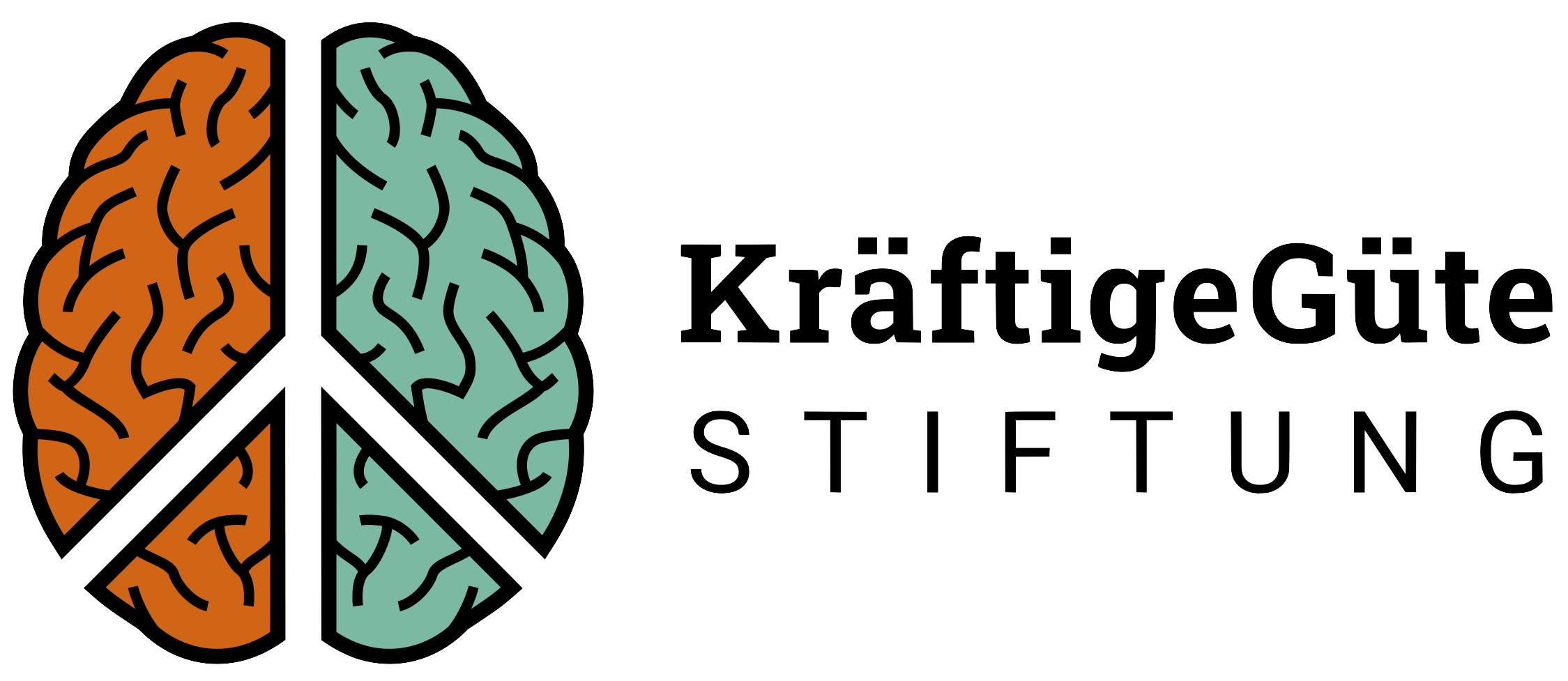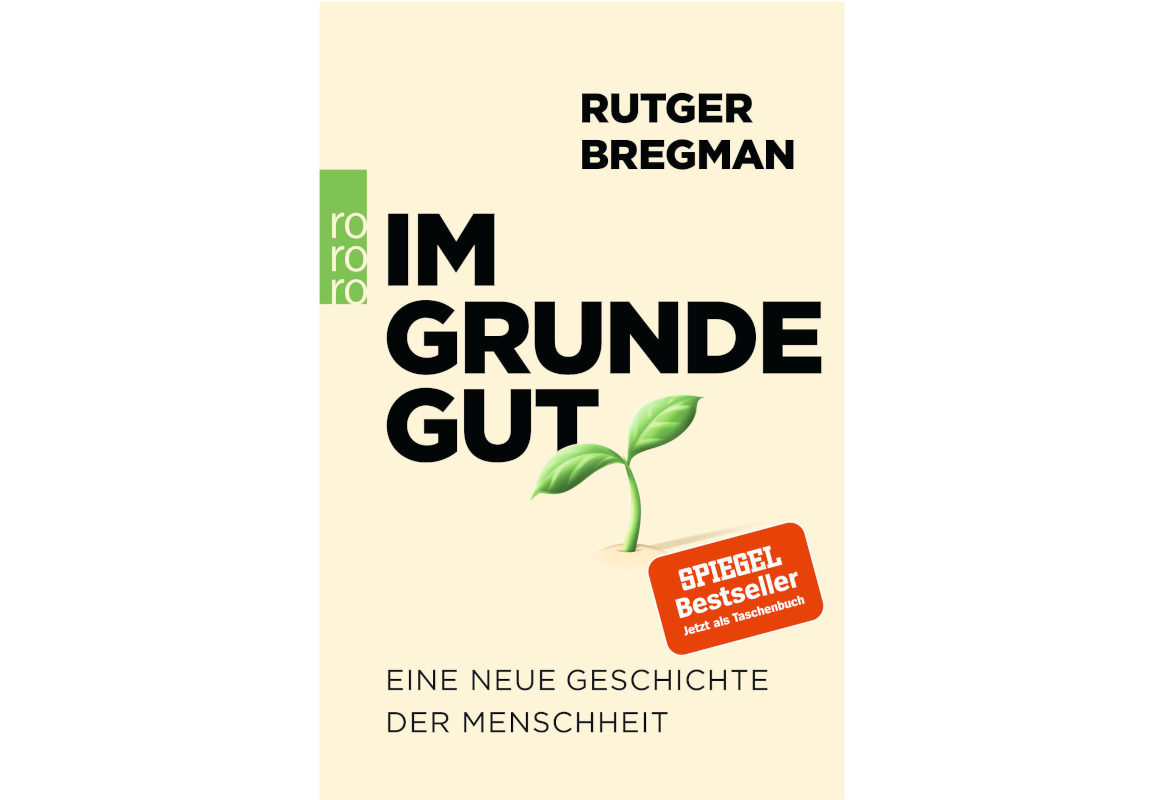Was wäre, wenn der Mensch im Grunde gar nicht egoistisch und grausam ist – sondern gut? Dieser rousseauschen Annahme widmet sich Rutger Bregman in seinem Buch „Im Grunde gut“. Mit zahlreichen Beispielen und Fakten zeigt er auf: Menschen entscheiden sich in der Regel aus eigener Motivation für gütiges und gegen gewaltvolles Handeln.
Die meisten Justizsysteme weltweit basieren auf der Annahme, dass wir nur durch Strafen auf den rechten Weg gebracht werden können. Polizeiarbeit basiert vielfach auf der Annahme, dass Kontrolle nötig ist, weil man den Menschen nicht trauen kann. Und in der Politik gilt Misstrauen fast schon als Grundhaltung – sei es bei Sicherheitsgesetzen oder im Umgang miteinander.
Genau hier setzt Rutger Bregman mit „Im Grunde gut“ an und widerspricht dieser Haltung. In Anlehnung an Jean-Jacques Rousseau wirft das Buch folgende Fragen auf: Was, wenn all diese Annahmen falsch sind? Was, wenn der Mensch im Kern nicht schlecht, sondern gut ist?
Dann wären Strafe, Kontrolle und Misstrauen an vielen Stellen völlig überflüssig.
„Es ist eine Idee, die Machthabern seit Jahrhunderten Angst einjagt, gegen die sich unzählige Religionen und Ideologien gewandt haben. […] Gleichzeitig ist es eine Idee, die von nahezu allen Wissenschaftsbereichen untermauert, die von der Evolution erhärtet und im Alltag bestätigt wird.“
„Im Grunde gut“ stellt die gewohnte, meist negative Sicht auf die Menschheit radikal auf den Kopf. Statt ständig vom „egoistischen“ oder „gewaltbereiten“ Menschen auszugehen, zeigt Bregman anhand vieler Beispiele aus Geschichte, Psychologie, Biologie und Alltagskultur: Kooperation, Vertrauen und Mitgefühl sind viel stärker, als wir denken.
In seinem Buch greift er Experimente, die die Boshaftigkeit des Menschen beweisen sollen, auf und hinterfragt ihre Korrektheit und Aussagekraft. Dazu gehören etwa das Milgram-Experiment, das zeigen soll, dass Menschen unter Autorität bereit sind, anderen Schmerzen zuzufügen, oder das Standford-Prison-Experiment, dessen Fokus darauf liegt, zu verdeutlichen, wie schnell Menschen in Machtrollen ihr Verhalten verändern.
Bregman führt zahlreiche Gegenbeispiele für gütiges Handeln an, etwa Unternehmen, die ohne klassisches Management funktionieren, Kommunen von Kindern auf verlassenen Inseln oder Solidarität innerhalb von Zivilbevölkerungen in Krisensituationen.
All diese Beispiele zeigen: Vielleicht müssen wir die Geschichte der Menschheit ganz neu denken. Mit der Prämisse, dass die Menschen im Grunde gut sind. Denn das könnte Bregman zufolge weitreichende Folgen für unser aller Leben haben.
„Wenn wir glauben, dass die meisten Menschen im Grunde nicht gut sind, werden wir uns auch dementsprechend behandeln. Dann fördern wir das Schlechteste in uns zutage. Letztendlich gibt es nur wenige Vorstellungen, die die Welt so sehr beeinflussen wie unser Menschenbild. Was wir voneinander annehmen, ist das, was wir hervorrufen. Wenn wir über die größten Herausforderungen unserer Zeit sprechen – von der globalen Erderwärmung bis zum schwindenden gegenseitigen Vertrauen –, glaube ich, dass deren erfolgreiche Bewältigung mit der Entwicklung eines anderen Menschenbildes beginnt.“
Die besondere Stärke des Buches liegt in diesem Perspektivwechsel.
Statt den Menschen immer als Gefahr für andere zu sehen, erkennt man, wie sehr Zusammenhalt, Freundschaft und Verständnis unser Zusammenleben prägen. Dieser Perspektivwechsel ist das Herzstück des Buches – er lässt einen das Gute in der Menschheit erkennen.
In „Im Grunde gut” macht Bregman keinen Halt vor den ganz großen Fragen: Wie funktioniert Gesellschaft? Warum glauben wir so hartnäckig an das Böse im Menschen? Und wie sähen Justiz, Politik, Wirtschaft und Zusammenleben aus, wenn wir das Gute stärker in den Mittelpunkt stellen?
Mit Humor, spannenden Geschichten und klugen Lösungsansätzen trifft Bregman den Sweet Spot zwischen Unterhaltung und Tiefgang. „Im Grunde gut“ ist ein Augenöffner – ein Buch, das die Sicht aufs Leben verändern kann.
„Im Grunde gut” von Rutger Bregman wurde im Deutschen im Rowohlt-Verlag veröffentlicht. Im Taschenbuchformat kostet es 15 Euro und als E-Book 11,99 Euro.
Beitragsbild: Rowohlt