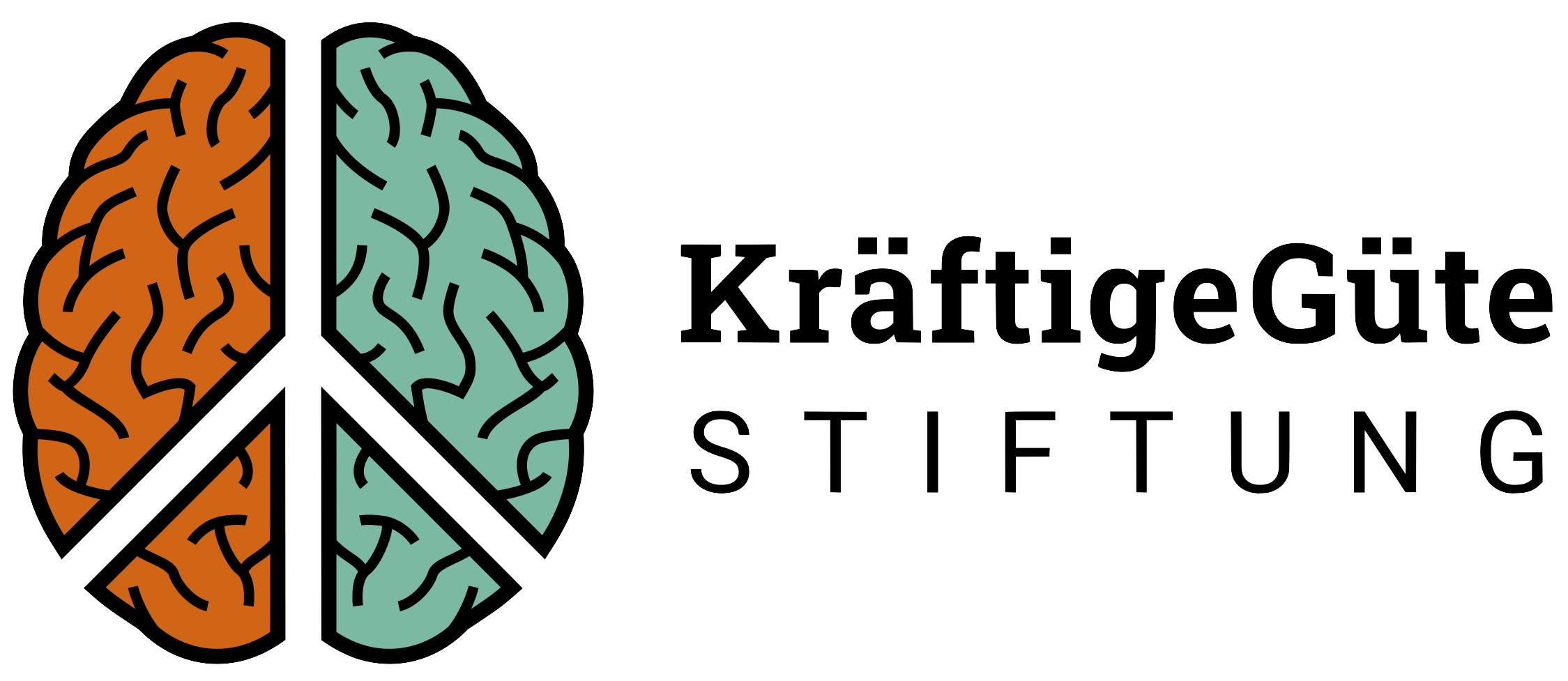Alles begann mit Schulessen für Kinder im kolumbianischen Bürgerkrieg. Zwanzig Jahre später schaffen es David Höner und seine Cuisine sans Frontières, dass mancherorts sogar Soldaten und Rebellen für eine Mahlzeit ihre Waffen niederlegen und miteinander ins Gespräch kommen.
Ihren Ansatz der Küchendiplomatie setzt die Küche ohne Grenzen in den größten Krisenregionen weltweit um. Dort fördern Wirtshäuser, Restaurants und haushaltswirtschaftliche Ausbildungsstätten berufliche Perspektiven ebenso wie Begegnung und gewaltfreien Austausch zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren.
David Höner ist Jahrgang 55, aber wenn es um die Projekte seiner Cuisine sans Frontières geht, berichtet er mit der Begeisterung eines jungen Mannes, der die Küchendiplomatie gerade erst für sich entdeckt hat. Dabei gründete der gelernte Koch vor zwanzig Jahren bereits einen ehrenamtlichen Verein, dessen erstes Projekt der Aufbau einer Gemeinschaftsküche mitten im kolumbianischen Bürgerkrieg war. Seitdem sind viele Freiwillige zur „Küche ohne Grenzen“ dazugekommen, die in unterschiedlichen Krisen- und Kriegsgebieten weltweit mit lokalen Partnerorganisationen Räume der Begegnung durch gemeinsames Essen und Kochen schaffen.
FLORIAN VITELLO: David, ich erreiche dich im Zuge eines Events von Cuisine sans Frontières (CsF), ausnahmsweise heute in deiner Schweizer Heimat.
DAVID HÖNER: Ja, genau. Vor zwanzig Jahren haben meine Frau und ich beschlossen, nach Ecuador auszuwandern. Das Land war lange ein Hort des Friedens.
VITELLO: Bis vor kurzem hagelte es gute Nachrichten aus Ecuador. Im Moment ist die Gesellschaft aber in einer tiefen Krise. Die Cuisine sans Frontières arbeitet dort heute mit indigenen Gruppen und staatlichen Akteuren. Wie kamst du ursprünglich auf die Idee, soziale Themen diplomatisch über Essen anzupacken?
HÖNER: Ich bin gelernter Koch, habe auch lange in dem Beruf gearbeitet, mich dann aber als Quereinsteiger auf Food-Journalismus spezialisiert. Der Fokus meiner Berichterstattung lag auf der Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel. Eine größere Schweizer Zeitung beauftragte mich 2005, eine Reportage über Sprühflugzeuge im kolumbianischen Putumayo zu machen.
„Wie kann man die Zivilgesellschaft so unterstützen, dass die Leute wieder miteinander in Kontakt kommen und sich über Lösungen für ihre Probleme austauschen?.“
Das wurde damals offiziell im Rahmen des „War against Drugs“ (Krieg gegen Drogen) legitimiert. Tatsächlich ging es darum, die kolumbianische Guerilla zu bekämpfen. Die Kämpfe und die Sprühaktionen zerstörten vor allem jedoch die zivile Infrastruktur. Will heißen, am Konflikt Unbeteiligte trauten sich gar nicht mehr vor die Türe. Ganze Familien vereinsamten. Auch das Ackerland wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bauern gerieten in Abhängigkeit und wurden von allen Kriegsfronten missbraucht. Das war und ist bis heute eine unglaubliche Tragödie.
Ich kam entsprechend erschrocken zurück, habe die Reportage geschrieben und mich gefragt: „Wie könnte man die Zivilgesellschaft so unterstützen, dass die Leute wieder miteinander in Kontakt kommen und sich über Lösungen für ihre Probleme austauschen?“ Mit befreundeten Gastronomen in der Schweiz habe ich dann gesagt: „Lass uns doch da ein Restaurant aufmachen, wo die Zivilgesellschaft am meisten leidet.“
VITELLO: Weshalb der gastronomische Ansatz?
HÖNER: Das lag nahe, weil für uns ein Restaurant viel mehr ist als nur ein Ort, um Essen und Trinken zu sich zu nehmen. Im Restaurant begegnen sich Menschen. Und diese Begegnungen wollten wir im Krisengebiet möglich machen, damit Dialoge zwischen Konfliktparteien entstehen. Das war etwas großspurig und naiv von uns.
VITELLO: Das Ziel ist zweifelsohne ambitioniert, aber warum naiv, wenn es funktioniert hat? Ihr habt später sogar mit politischen Vertreter:innen gearbeitet.
HÖNER: Es hat funktioniert, aber nicht so, wie wir uns das blauäugig vorgestellt hatten. Zuallererst brauchten wir einen Kontakt vor Ort. Ich hatte das enorme Glück, noch in Kolumbien die großartige Claudia Quartas, damals Bürgermeisterin von Apartaló, kennengelernt zu haben. Sie war überzeugt, sollte das Unterfangen gelingen, müssten wir in einer kleinen Friedensgemeinschaft namens San Josecito beginnen. (Ein mit Friedenspreisen prämiertes Dorf, das sich 1997 der Gewaltfreiheit verschrieb: Waffen werden nicht geduldet, Alkohol im Dorf ist verboten, und es werden keine Informationen an bewaffnete Gruppen weitergegeben). Claudia Quartas hat uns dann vermittelt.
Zweitens war unsere ursprüngliche Idee, ein Restaurant zu errichten, in dem wir das Essen gegen einen kleinen Beitrag abgeben. Wir haben aber sofort gemerkt, dass die Leute wirklich praktisch gar kein Geld hatten. Und dann haben wir begonnen, uns mit dem Dorfrat zu beraten, der uns am Anfang sehr misstrauisch gegenüberstand. Die wussten natürlich nicht genau, was wir eigentlich wollen. Aus der anfänglichen Skepsis ist aber sehr schnell ein Vertrauensverhältnis entstanden.
VITELLO: Mir scheint, ihr habt schnell eine Strategie gefunden, die bis heute wegweisend ist: Claudia Quartas war die perfekte politische Partnerin. In der aktuellen Regierung ist sie verantwortlich für die Umsetzung des Friedensabkommens.
Auch wer bei euch ein neues Projekt vorschlagen will, muss passende lokale Partner:innen mitbringen. Damit habt ihr euch schon früh bewusst von alten Strukturen gelöst, in denen westliche Geldgeber allein über die Verwendung von Hilfsmitteln bestimmen.
Wie findet ihr den Zugang zu engagierten, verlässlichen Politiker:innen, Aktivist:innen oder Organisationen vor Ort?
HÖNER: Ganz oft sind es die Kinder. Im ersten Projekt war das auch so. Wir sind damals zu dritt auf eigene Kosten nach San Josecito. Im Gepäck hatten wir 16.000 Schweizer Franken Jahresbudget, die wir bei Freunden und Familie als Spenden eingesammelt hatten. Die haben wir direkt eingesetzt, um eine kleine Schulküche zu bauen. Denn es gab dort viele Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, und um die sich die Gemeinschaft gekümmert hat.
Für die haben wir dann Mittagessen gekocht. Im nächsten Schritt haben wir die Küche auch abends für die Erwachsenen geöffnet. Das Abendessen haben wir aus ganz bescheidenen Sachen gemacht, also wie in Kolumbien üblich, aus Reis und Bohnen, Mais oder ein bisschen Fleisch, wenn es welches gab.
Wir haben bewusst nicht unsere Küche dahin getragen, sondern mit lokalen Produkten gearbeitet. Das kam wahnsinnig gut an, weil die Leute unter Dauerstress gearbeitet haben. Die wenigen Felder, die sie noch hatten, waren zum Teil vermint; die Produktion reichte nicht, um ihre Familien zu ernähren, und genügend Geld zum Einkaufen war auch nicht da. In dem Dorf lebten damals etwa 80 Familien. Und da konnten wir mit unserem Abendessen ein bisschen helfen.
VITELLO: Haben die Menschen das Angebot angenommen?
HÖNER: Ja, sie wussten schließlich, dass wir auch für die Kinder kochen. Wir haben die Gemeinschaftsküche dann um 17 Uhr geöffnet und erst um 20.30 Uhr wieder geschlossen, denn die Leute kamen zu einem richtigen Treff zusammen. Daraus ist dann mit der Zeit ein echtes kleines Dorfrestaurant und eine Dorfkneipe entstanden. Das hat uns bestätigt, dass unser Konzept funktioniert.
Wir waren vier Monate da und haben im Laufe der kommenden Jahre immer wieder Volunteers hingeschickt. Wir haben die Leute dann zunehmend darum gebeten, uns Lebensmittel zu geben, die wir verarbeiten können. Sie haben einfache Produkte wie Yucca und Kochbananen oder etwas Reis mitgebracht. Wir haben Öl oder Salz dazu gekauft und gekocht. So ist eine Art Tauschwirtschaft entstanden, vor allem auch mit Arbeit.
VITELLO: Heißt, wer weder Feld noch Geld hatte, konnte mitkochen und dann mitessen?
HÖNER: Richtig, das war besonders für die Frauen wichtig. Wir haben einen Küchenplan gemacht, in dem verschiedene Leute aus der Dorfgemeinschaft nach und nach für das Essen zuständig waren. Und wir sind dann zum Beispiel mit einem Auto einkaufen gefahren. Auch hier zeigt sich wieder unsere Naivität – wir wussten nicht, wie gefährlich das war! Das haben wir komplett unterschätzt.
Aus dem Küchenplan wiederum entwickelte sich ein richtiges Hauswirtschaftsprojekt, in dem nicht nur das Kochen, sondern auch Abläufe und Strukturen, Menüplanungen und Kostenkalkulation gelernt werden konnten. Die Unterstützung im Dorf wurde so immer größer. Es gab da einen Jesuiten, Padre Javier Giraldo. Der wurde später Mitglied der Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der Kriegsverbrechen während des Bürgerkrieges. Aber damals betreute er die Friedensgemeinschaft San Josecito und unserem Projekt hat er ein super Zeugnis ausgestellt. Das war ein Durchbruch. So konnten wir das Projekt schließlich an die Frauen übergeben, die bei uns arbeiteten.
VITELLO: Wie schwer ist es euch gefallen, das Projekt aus der Hand zu geben?
HÖNER: Überhaupt nicht. Ich finde, das ist das Wichtigste, dass Hilfsprojekte irgendwann zum Selbstläufer werden. Das hat mich glücklich gemacht. Außerdem wussten wir jetzt, dass unser Ansatz funktioniert und auch wie er funktioniert. Da haben wir direkt das nächste Projekt in Brasilien geplant, mit der Organisation von Sem Terra, also den Landlosen in Salvador de Bahia. Die lebten auf einem großen besetzten Gelände außerhalb der Stadt, das waren eigentlich Favelas.
VITELLO: Die Länder und Gemeinschaften sind teils sehr unterschiedlich – inwiefern seid ihr in Brasilien wieder genauso vorgegangen wie in Kolumbien?
HÖNER: Die Ausgangslage ist natürlich immer eine andere, aber wir hatten mit Cuisine sans Frontières eigentlich fast überall auf der Welt die gleiche Herangehensweise: Niedrigschwellig anfangen, zum Beispiel kochen für Kinder, und dann die lokale Bevölkerung einbeziehen. Häufig finden sich auch strategische Partner in der Politik oder Geldgeber vor Ort. In Brasilien haben wir mit den Guerrieras sem Teto gearbeitet, einer Frauengruppe, die leer stehende Gebäude und Flächen für wohnungslose und arme Menschen nutzbar macht.

Irgendwann kamen die ersten Anfragen von staatlichen Entwicklungshilfe-Organisationen. Wir haben später in Kolumbien noch ein Projekt hochgezogen, dann kam eine Schulküche im Kongo dazu und eine Anfrage aus Kenia. In den letzten Jahren haben wir auch mit geflüchteten Menschen gearbeitet in Griechenland und es sind Projekte im Libanon entstanden.
VITELLO: Die Liste der Einsatzorte wurde immer länger, aber finanziert habt ihr das Ganze vor allem aus Spenden. In der Schweiz sind eure Veranstaltungen legendär, bei denen berühmte Köch:innen gegeneinander antreten. Dafür zahlen die Besucher:innen gerne und spenden großzügig.
Ihr könntet auch vermehrt auf große staatliche Fördertöpfe setzen, stattdessen sucht ihr eher strategische Partnerschaften in der Lokalpolitik. Und auch vor Ort setzt ihr nicht auf Sterneküche, sondern simple regionale Gerichte – warum?
HÖNER: Weil ein ganz wichtiger Bestandteil der Arbeit, um über Essen Frieden zu schaffen, für uns bei Cuisine sans Frontières darin besteht, sich an die Essgewohnheiten der Menschen anzupassen. Da gilt das alte Sprichwort: „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht“. Wenn ich jetzt mit meiner internationalen Ausbildung als Koch in der Schweiz oder in Deutschland den Brasilianer:innen Köstlichkeiten der internationalen Gastronomie auf den Teller bringe, sind die Menschen skeptisch und überfordert. Sie wünschen sich stattdessen eine Feijoada, einen Bohneneintopf.
Wenn das Nationalgericht komplett, also in der reichhaltigsten und aufwendigsten Variante zubereitet wird, werden traditionell Trockenfleisch, Räucherwürstchen, Zunge, Schweineohren und -füße, Nelken, Lorbeer, ganze schwarze Pfefferkörner, Knoblauch und Zwiebeln zusammen eingekocht; dazu werden Reis, Blattkohl, Orangenscheiben, geröstetes Maniokmehl und eine Pfeffersoße gereicht. Für die Menschen ist das ein absolutes Festessen. Das kann man sich aber gar nicht jeden Tag leisten.
Darum arbeitest du dann viel mit Bohnen und Reis oder Fladen aus Maisbrei. Eben mit dem, was die Leute lieben und täglich essen. Wir haben anfangs fünf Tage die Woche traditionell gekocht und zwei Tage versucht, unsere Kochkunst anzubieten. Das hat nicht funktioniert. Das wollte niemand. Außer bei Pizza. Pizza funktioniert immer. Sei es in der Wüste, im Regenwald oder auf einer Mittelmeerinsel.
VITELLO: Woran liegt das, dass die Menschen etwas, was sie noch nicht kennen, nicht annehmen?
HÖNER: Essen ist nicht nur Hungerbefriedigung. Essen ist ein Kulturgut und nicht zuletzt Identität. Ich bin selber in der Schweiz auf dem Land mit ganz bestimmten Fruchtkuchen aufgewachsen, die kamen aus der Region. Unser Essen war oft noch so, wie es sein sollte: Regional und saisonal. Man wird dann auch stolz auf seine eigenen Spezialitäten und freut sich darüber. Wenn ich meinen Nachbarn sage, sie sollen jetzt Glasnudeln mit geschnittenem Chinakohl essen, dann lehnen sie das auch dankend ab.

In den Projekten der Cuisine sans Frontières geht es nicht darum, Menschen das Kochen beizubringen, das können sie selber. Aber, das hat sich von Projekt zu Projekt gezeigt: Die Menschen dabei zu unterstützen, das Eigene anzubieten – sich zu organisieren, sodass keine Lebensmittel verloren gehen, Wochenpläne zu erstellen, Resteverwertung, das sind die ersten und wichtigsten Ausbildungsschritte, um ein Projekt auch wieder zu übergeben und Frieden durch Küchendiplomatie möglich zu machen.
„Entgegen größerer innerer Widerstände haben wir dann beim lokalen Militärkommando angefragt und die haben uns einen Lastwagen voll Soldaten geschickt. Die waren letztendlich auch einfach da und haben genau wie alle anderen gegessen und getrunken.“
VITELLO: Die Tage erst ist es wieder so weit, dann zieht sich Cuisine sans Frontières im Northwest Rift Valley in Kenia zurück. Der Konflikt dort zwischen Angehörigen der Pokot und der Turkana, zweier großer ethnischer Gruppen, wurde noch lange nach der britischen Kolonialzeit aufgeheizt, indem die Regierung jeweils deren politische Führung bestimmte.
Mit den heutigen Kriegen im Sudan und in Uganda wurde eine Straße, die sich durch das Turkana-County zieht, zu einer Nachschubroute für Waffen und Güter aus Mombasa. Dadurch wurde der Konflikt noch gewalttätiger. Wo fängt man in einer solch komplizierten und verzwickten Lage an mit Küchendiplomatie?
HÖNER: Wir haben zuallererst mit den Vorstehenden der Pokot und der Turkana verhandelt und das Calabash-Restaurant gebaut. Auch hier haben wir wieder ein Programm hauswirtschaftlicher Ausbildung gestartet. Hier mit einer Kamelzucht, Honigproduktion und Seidenraupen. In dem Zentrum dafür gab es aber auch Filmabende, Feiern und Sportfeste.
VITELLO: Und da kommen dann Pokot und Turkana einfach so zusammen oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
HÖNER: Das war am Anfang wahrlich nicht einfach. Die beiden Gruppen begegneten sich mit tiefstem Misstrauen. Wenn aber ein Pokot kocht und eine Turkana gibt die Getränke aus, dann kommen ein paar Leute. Und dann bietet man Veranstaltungen an, die man natürlich mit den führenden Personen der Turkana und der Pokot abspricht. Hier sind wir auf Zuspruch gestoßen, denn es gibt schon länger Friedensbemühungen von beiden Seiten.
Zum Beispiel haben wir bei den Sporttagen immer wieder zum Sackhüpfen eingeladen für die Kinder sowohl der Turkana-Schule als auch der Pokot-Schule. Sowas braucht viel Vorlauf. Am Anfang war es auch so, dass die Pokot um Schutz gebeten haben. Entgegen größerer innerer Widerstände haben wir dann beim lokalen Militärkommando angefragt und die haben uns einen Lastwagen voll Soldaten geschickt. Die waren letztendlich auch einfach da und haben genau wie alle anderen gegessen und getrunken.
VITELLO: Und die Pokot und Turkana?
HÖNER: Zuerst sitzen die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Dann gibt es was zu essen. Das Tolle ist, beide Gruppen haben dasselbe Lieblingsgericht. Das ist „nyama choma”, also gebratenes Fleisch – in diesem Fall Ziegenfleisch. Darum haben wir eine eigene Ziegenherde dort. Die Teller geben wir nur an einer Ausgabestelle aus, damit sich schon hier die Leute ein bisschen vermischen. Zumindest die Kinder, denn die haben sowieso keine Probleme miteinander. Alle müssen natürlich vorher ihre Waffen abgeben. Und dann gibt es eine Ansprache, um einen offiziellen Rahmen zu schaffen, und wir veranstalten ein paar Wettbewerbe.
VITELLO: Jetzt haben zwei Kriegsparteien nicht immer zufällig dasselbe Lieblingsgericht oder dieselben Traditionen. Inwiefern kann der Ansatz der Küchendiplomatie von Cuisine sans Frontières auch bei grundverschiedenen Konfliktparteien zu Frieden beitragen?
HÖNER: Egal, wo auf der Welt du dich umschaust: Es gibt wahrscheinlich keinen kleineren gemeinsamen Nenner für alle Menschen als Essen und Trinken. Ich meine, jeder muss essen und trinken. Das ist in jeder Kultur, jeder Volksgruppe, selbst wenn Kulinarik gerade stiefmütterlich behandelt wird, immer im Zentrum des täglichen Lebens. Wenn alles andere wirklich schief läuft, geht es nur noch darum: „Wie beschaffe ich das tägliche Essen und Trinken zum Überleben?“
VITELLO: Das ist doch auch ein gutes Argument, um die Bürgermeisterin oder den Stadtrat mit an Bord zu holen!
HÖNER: Genau! Fast jeder Mensch hat einen Bezug dazu. Das kann eine Lieblingsspeise sein oder eine Erinnerung an ein Gericht aus der Kindheit. Wenn wir Frieden fördern wollen, müssen wir nicht nur Flugblätter verteilen, sondern wir müssen an die Essenz, die Existenz eines jeden Menschen gehen. Und dann können wir uns auf Essen und Trinken konzentrieren, ohne den Anspruch zu haben, vor Ort Leuten zu erklären, was sie zu tun haben. Das Wichtigste ist, einfach für sie da zu sein und sie zu unterstützen. Dieser Akt der Güte, dieses gemeinsame Teilen, ist ein ungeheuer großer Schritt in Richtung Frieden.
Beitragsbild: Cuisine sans Frontières