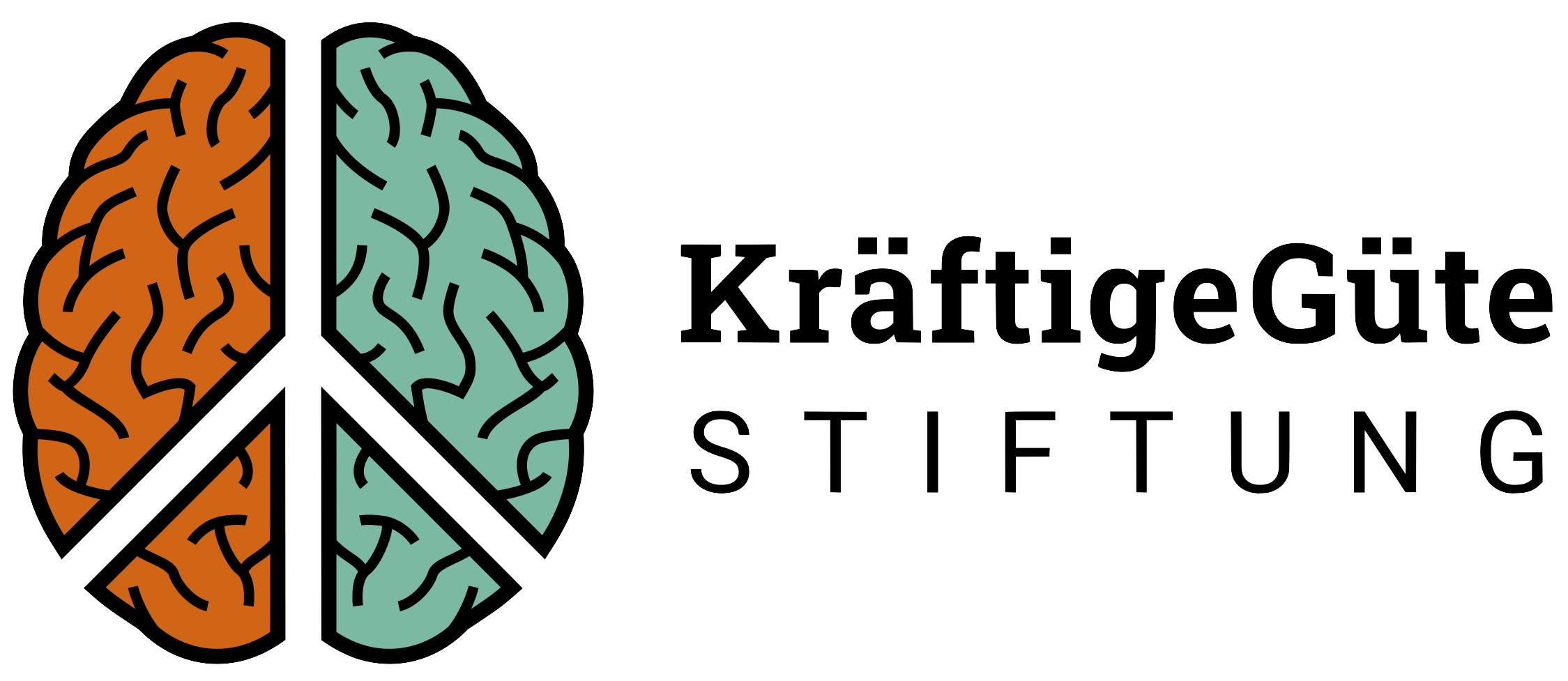Norwegens Gefängnissystem setzt auf Vertrauen, Respekt und Resozialisierung. Die Gefängnisinsel Bastøy sticht besonders heraus. Sie beweist, dass Norwegens gütekräftiger Ansatz funktioniert.
Für das Haftsystem in Norwegen gilt der Grundsatz, dass der Freiheitsentzug die Strafe ist, nicht das Leben im Gefängnis. Der Strafvollzug in dem skandinavischen Land basiert auf einem Leitprinzip, das auf den ersten Blick überraschend wirkt: Normalität. Gefängnisse sollen nicht abgegrenzt von der Gesellschaft existieren, sondern ihr möglichst nahekommen. Gefangene kochen selbst, kümmern sich um ihre Wäsche, gehen arbeiten oder zur Schule und übernehmen Verantwortung. Denn auch wenn die Gefangenen ihre Freiheit verlieren, sollen ihre anderen sozialen Grundrechte so weit wie möglich erhalten bleiben.
So funktioniert Haft in Norwegen
In vielen europäischen Ländern gelten Gefängnisstrafen noch immer als Hauptinstrument der Strafverfolgung, selbst bei kleineren Delikten. Alternativen zur Haftstrafe werden zwar in Deutschland immer häufiger genutzt, ausgeschöpft sind die Optionen aber noch lange nicht.
Fast 40 Prozent aller Inhaftierten in Deutschland sitzen mit Freiheitsstrafen unter neun Monaten im Gefängnis. Dabei „wissen alle Vollzugspraktiker, dass man in der Zeit wenig verändern kann“, merkt Strafvollzugsexperte Bernd Maelike an.
In Norwegen wird das grundlegend anders angegangen. Dort folgt der Strafvollzug einem stufenweisen System mit dem ausdrücklichen Ziel der Resozialisierung.
„In Norwegen bleibt der Inhaftierte Staatsbürger. In Deutschland ist er dem besonderen Gewaltverhältnis des Staates unterworfen und wird zum Gefangenen.“
Wer in Norwegen zu kurzen Freiheitsstrafen verurteilt wird, etwa unter vier Monaten, verbüßt diese meist nicht im Gefängnis, sondern bleibt zu Hause unter elektronischer Überwachung, etwa mit einer Fußfessel. So verlieren Ersttäter:innen nicht ihr soziales und berufliches Umfeld. Für längere Haftstrafen beginnt der Vollzug meist in einer geschlossenen Anstalt.
Danach wechseln viele Gefangene in Einrichtungen mit weniger Sicherheitsvorkehrungen, wo sie mehr Eigenverantwortung übernehmen. Die letzte Phase sind sogenannte Halfway Houses, offene Einrichtungen, in denen die Häftlinge tagsüber arbeiten oder zur Schule gehen können.
Bastøy: Eine Insel der Resozialisierung
Ein Beispiel für diese Form des offenen Strafvollzugs ist die Gefängnisinsel Bastøy. Dorthin zu kommen, gilt aufgrund besonders guter Resozialisierungsmöglichkeiten als erstrebenswert und kann beispielsweise durch tadelloses Verhalten in einem anderen Gefängnis erreicht werden.
„Ich vertraue meinen Insassen. Das spüren sie vom ersten Tag an, wenn sie plötzlich ohne Handschellen alleine auf der Insel stehen und dieses Maß an Freiheit gar nicht mehr gewohnt sind.“
Tom Eberhardt, Gefängnisdirektor in Bastøy
Bastøy befindet sich 75 Kilometer südlich von Oslo, im Oslofjord. Von den 115 Gefangenen dort sind viele wegen schwerer Verbrechen wie Gewalt-, Drogen- oder Sexualdelikten inhaftiert.
Die Gefangenen wohnen in Einzelzimmern mit eigenem Bad und Küchenzeile in Holzhäusern, kochen gemeinsam, arbeiten in der Landwirtschaft oder übernehmen für die Gemeinschaft Aufgaben im Inselalltag, etwa in der Küche oder beim Fährdienst. Die Miete für ihr Zimmer zahlen sie aus dem eigenen Einkommen. In der Freizeit können sie wandern, angeln oder Sport treiben. Auch der Kontakt zur Familie wird ermöglicht und gefördert. Gitter oder Handschellen gibt es nicht und die Sicherheitskräfte tragen weder Uniform noch Waffen.
Was auf den ersten Blick wie ein Feriendorf wirkt, ist Teil eines durchdachten Resozialisierungskonzepts.
„Es bringt nichts, Häftlinge in die schlechtmöglichste Umgebung zu setzen – das müssen wir der Öffentlichkeit noch besser vermitteln.“ Tom Eberhardt, Gefängnisdirektor in Bastøy
Statt Kontrolle steht Vertrauen im Mittelpunkt. Wer flieht, verliert seinen Platz auf der Insel und wird in ein strengeres Hochsicherheitsgefängnis zurückverlegt. Wärter:innen werden nicht als Kontrollinstanz eingesetzt, sondern als pädagogische Begleitung, die ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung und des Arbeitsalltags der Häftlinge ist.
Diese Form der engen, menschlichen Beziehung soll das Vertrauen stärken und gleichzeitig die Eigenverantwortung fördern. Damit das funktioniert, braucht es deutlich mehr Personal als in anderen Gefängnissen: Auf rund 260 Insassen kommen circa 230 Vollzugsbeamte. Das Ziel besteht darin, die Häftlinge auf ein Leben nach der Haft vorzubereiten – mit einem Fokus auf persönlicher Weiterentwicklung statt Bestrafung.
Ein System, das funktioniert
Die Zahlen sprechen für sich: Die Rückfallquote liegt in Norwegen bei unter 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren, in Bastøy sogar bei nur 16 Prozent. In vielen anderen europäischen Staaten liegt sie hingegen zwischen 50 und 70 Prozent, in Deutschland bei etwa 46 Prozent innerhalb von drei Jahren. Gewalttätige Auseinandersetzungen oder gar Fluchtversuche gibt es laut dem Gefängnisdirektor von Bastøy fast gar nicht. Zu hoch sei das Risiko, wieder in ein Gefängnis mit strengeren Sicherheitsvorkehrungen verlegt zu werden und die hier gewährten Privilegien zu verlieren.
Ex-Häftlinge in Norwegen finden oft schnell wieder Arbeit und sind damit seltener auf Sozialleistungen angewiesen. Dass dies auf den Schwerpunkt auf Rehabilitation und Berufsausbildung in den Haftanstalten in Norwegen zurückzuführen ist, ist wissenschaftlich belegt.
Der gesellschaftliche Nutzen ist klar: weniger Rückfälle, geringere Folgekosten, mehr Integration. Kein Wunder also, dass Norwegens Haftsystem in Europa als vorbildhaft gilt.
Das norwegische Beispiel zeigt, dass ein humanerer Strafvollzug weder naiv noch unrealistisch ist. Er kann Sicherheit und Resozialisierung miteinander verbinden und so für die gesamte Gesellschaft wirken. Menschlichkeit im Strafvollzug ist keine Schwäche, sondern eine Stärke – und eine Option, die sich langfristig auszahlt.
Beitragsbild: Wikimedia Commons